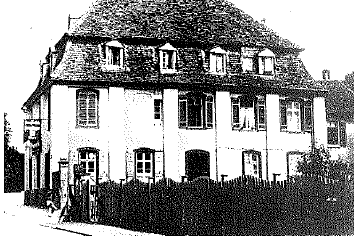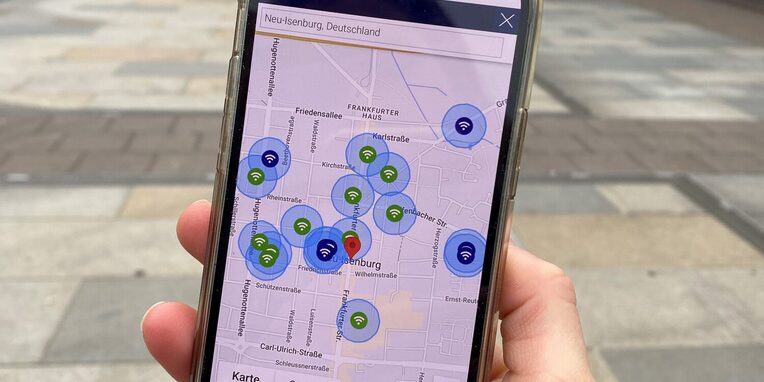Die Bansamühle zählt mit zu den Wahrzeichen der Stadt Neu-Isenburg. Sie wurde 1705 von Andreas Löber als Wassermühle errichtet und ist heute einer der beliebtesten Orte für standesamtliche Trauungen in der Hugenotten- und Waldenserstadt. Im letzten Jahr (2024) gaben sich hier 90 Paare das Ja-Wort. In diesem Jahr feiert die „Löber-Mühle“ ihr 320-jähriges Bestehen.
Gebaut wurde die Mühle 1704/1705 von Andreas Löber, dem Baumeister des Grafen Johann Philipp von Ysenburg und Büdingen.
Die Löbersche Mühle
Andreas Löber errichtete eine Mühle mit zugehörigem Wohnhaus und Wirtschaftsgebäuden – allerdings wesentlich opulenter als die Häuser der Hugenottensiedlung. Statt einem schlichten Satteldach wählte er für das zweigeschossige Gebäude ein walmisiertes Mansardendach. Fünf Achsen gliedern die Haupt-, drei Achsen die Nebenfront. Im Erdgeschoss befinden sich vier Fenster und die Eingangstür, im Obergeschoss genau darüber liegend fünf Fenster, die Seitenfassade trägt in jedem Geschoss drei Fenster. Die Fenster sind rechteckig mit einem gedrückten Rundbogen abgeschlossen. Die Vertikale wird durch aufgesetzte, pilasterartige Wandstreifen; die die Geschosse verbinden, stark betont. Zwei Sandstein-Torpfosten mit Kugelaufsatz markieren den Eingang. Weil der Luderbach nur nach starken Regengüssen ausreichend Wasser für die Mühle führte, wurde die Mühle auch im Volksmund „Blitz- und Donner-Mühle“ genannt.
1712 starb Löber und vermachte die Mühle seiner Herrin, der Gräfin Berleburg bzw. deren Tochter Wilhelmine Charlotte, die die zweite Gemahlin des Grafen Johann Philipp von Isenburg wurde. Der Graf verkaufte die Mühle wieder. Die Mühle wechselte mehrmals die Besitzer bis sie 1762 der Bankier Johann Wolfgang Schönemann, der Vater von Goethes späteren Verlobten Lilli, kaufte.
Die Bansamühle
1766 erwarben die Brüder Johann Conrad und Johann Matthias Bansa die Mühle und das Wohnhaus von der Witwe Schönemann. Hier pflegten die Bansas ihr Gesellschaftsleben und schufen sich einen behaglichen Landsitz in der Natur. Denn zur damaligen Zeit wurde alles, was vor den Stadttoren lag, zur Natur gezählt. Dazu gehörte auch das Dorf Neu-Isenburg. Inmitten von Gemüsegärten und Bleichwiesen, Viehweiden und Wäldern zum Holzschlagen gelegen, eignete es sich für das idealisierende Bild der gestalteten Natur. Ende des 18. Jahrhunderts wurde es Mode, dass die wohlhabenderen Frankfurter Familien sich Gartenhäuser und Sommersitze vor den Toren Frankfurts zulegten. Häufig wurden dabei landwirtschaftliche Höfe aufgekauft und teilweise umfunktioniert, wie die Bansamühle, die agrarwirtschaftlich genutzt wurde, und deren Haupthaus als Gartenhaus umgebaut wurde, in dem die Bansas ihre Sommer verbrachten.
Der Auszug aus der engen Stadt war gleichzeitig Ausbruch aus den engen Konventionen, denn vor der Stadt waren die Bürger ihren Verpflichtungen des Stadtbezirks enthoben. Innerhalb Frankfurts wurden die Bürger bis in den privatesten Bereich hinein reglementiert: Was angezogen, gegessen und gelesen werden durfte, war vorgeschrieben. Außerhalb der Stadt bestimmte allein das finanzielle Vermögen, welche Freiheiten möglich waren. Möbel, Lebensmittel, Bücher, die legal nicht in die Stadt gebracht werden konnten, wurden in die Gartenhäuser gebracht, von auswärtigen Besuchern und Geschäftsfreunden erfuhr der Rat nichts. Gartenhäuser waren somit Orte der bürgerlich liberalen Ungebundenheit und ermöglichten ein freies Leben.
Zu den „Mühlbürgern“, dem engeren Freundeskreis, der sich regelmäßig auf der Mühle traf, gehörten Goethes Mutter, die Familien Willemer, Brentano und Gontard. Zwar gibt es keine schriftlichen Zeugnisse, dass Goethe je selbst auf der Bansamühle zu Gast war, aber sicher ist sie ihm nicht unbekannt gewesen und die Freundschaft der Familien Goethe und Bansa wird in den Briefen der Cleophea Bansa (Ein Lebensbild in Briefen aus der Biedermeierzeit) oft betont.
Es fällt also nicht schwer, sich vorzustellen, wie Goethe im Garten der Bansamühle gesessen haben mag und ihm ein paar Zeilen für sein neues Drama eingefallen sind:
„Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet Groß und Klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein.“
Übrigens: In der Spielzeug-Sammlung des Historischen Museums Frankfurt befindet sich eine Nachbildung der Bansa-Mühle (ca. 30 Zentimeter x 60 Zentimeter), die Sophie Bansa von einem Isenburger Schreiner als Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder hatte anfertigen lassen.
Bis zum Jahr 1860 befand sich die Bansamühle im Besitz dieser Alt-Frankfurter Familie. 1889 ging sie in das Eigentum des Neu-Isenburger Bürgers Johann Grober über, dessen Sohn am 13. Januar 1900 eine Gartenwirtschaft darin eröffnete, die lange ein beliebtes Ausflugsziel war.
Die Bansamühle heute
1974 erwarb die Stadt Neu-Isenburg das stark beschädigte Gebäude. Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 11.9.1974 wurde die Bansamühle mit Gesamtkosten von rund 1 Mio. Deutsche Mark abgerissen und mit leichtverändertem Standort im Jahre 1975 aufgebaut. Bauleiter war Architekt Gutmann, Bauherr der Magistrat der Stadt Neu-Isenburg.
Im Jubiläumsjahr der Stadt, 1999, wurden die Außenanlagen komplett neu angelegt. Ein barocker Garten lädt zum kleinen Spaziergang ein. Im Jahr 2003 wurde der angrenzende Bansateich komplett saniert. Das gesamte Areal gehört zur Regionalparkroute Rhein-Main, dem Grüngürtel rund um Frankfurt.
Sanierung der Bansamühle von 2013-2015
Mit der Sanierung der Bansamühle wurde im Herbst 2013 begonnen. Das Dach wurde energetisch und schallschutztechnisch gedämmt und die Gaubenfenster durch energetisch wirksame Schallschutzfenster ersetzt. Von Oktober 2014 bis einschließlich Juni 2015 wurden die Innenräume, die Fassade und die Fenster der Bansamühle saniert sowie die WC-Anlage behindertengerecht umgebaut und erneuert.
Das Erdgeschoss wurde behindertengerecht ausgebaut. Dazu wurden die Außentüren verbreitert und ein Rollstuhl-Schrägaufzug eingebaut. Um Platz für eine behindertengerechte Toilette zu schaffen, wurden die Bestandstoiletten umstrukturiert. Die neuen Räume sind heller geworden, da der Tageslichteintrag optimiert wurde. Dafür wurden nicht mehr benötigte Außentüren durch Fenster ersetzt und die Türen zum Foyer und zum Treppenhaus mit lichtdurchlässigen Scheiben ergänzt. Bei der Innenraumsanierung werden die bereits vorhandenen und qualitativ hochwertigen Materialen aufgearbeitet und nur wo notwendig durch neue Werkstoffe ersetzt oder ergänzt. Zusätzlich wurde die Technik und das Brandschutzkonzept des Gebäudes überarbeitet.
Die Fassade der Bansamühle erstrahlt in einem neuen Anstrich und erhielt neue Fenster, die sich optisch an den Originalfenstern von 1920 orientieren. Konzeptionell wird das Erscheinungsbild der Bansamühle harmonisiert, indem eine klarere Trennung der unterschiedlichen Stilepochen herbeigeführt wird.
Heiraten in der Bansamühle
Die Bansamühle ist heute einer der schönsten Orte in Neu-Isenburg, um den Bund fürs Leben zu schließen. Im historischen Ambiente der Bansamühle finden die Trauungen freitags in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:00 Uhr statt. Zudem besteht die Möglichkeit an den ausgewiesenen Samstagen ebenfalls in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:00 Uhr dort getraut zu werden. Der Trausaal bietet Platz für das Brautpaar und bis zu 16 Gästen zuzüglich einem Fotografen / einer Fotografin. Die verfügbaren Samstagstermine stehen aktuell auf der Homepage https://neu-isenburg.de/rathaus_und_service/standesamt/trautermine (Öffnet in einem neuen Tab) . Die Vergabe der Freitagstermine erfolgt nach Absprache mit dem Standesamt. Um eine frühzeitige Planung der Trauung zu ermöglichen, besteht die Möglichkeit, den gewünschten Trautermin bereits ein Jahr im Voraus verbindlich zu reservieren. Hierfür entsteht eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 80 Euro. Für weitere Fragen steht das Team des Standesamts gerne zur Verfügung unter standesamtstadt-neu-isenburgde
Quellen: Historische Bauwerke in Neu-Isenburg, Verein für Geschichte,
Heimatpflege und Kultur, Neu-Isenburg (GHK) e.V., 1986
Siehe dazu auch: Wolfgang Pülm: Neu-Isenburg. Die Entwicklung der Hugenottenstadt, hrsg. v. d. Frankfurter Sparkasse, 2. Aufl, Frankfurt/M. 1999.